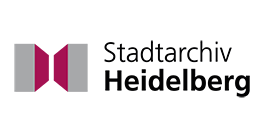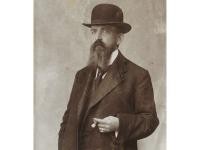Aktuelles aus dem Stadtarchiv
Geänderte Öffnungszeiten
Bitte beachten Sie, dass am 15. Mai 2024 wegen einer Veranstaltung die Benutzung nur bis 12 Uhr möglich ist.
Einweihung des Denkmals für die Toten der Neckarlager auf dem Friedhof Kirchheim
"Anfang März 1944", so beschreibt es die Einladung des Thaddengymnasiums, "fiel in Berlin auf höchster politischer Ebene der Beschluss, das kriegswichtige Daimler-Benz-Flugzeugmotorenwerk Genshagen/ Brandenburg bombensicher in die Stollen der Gipsgrube Obrigheim zu verlagern. Das Projekt erhielt den Tarnnamen „Goldfisch“. Im Lauf des Jahres 1944 entstanden in der Region um Obrigheim und Neckarelz sechs mit „Goldfisch“ verbundene KZ-Außenlager. Sie werden unter dem Namen „Neckarlager“ zusammengefasst. Über 5.000 Männer aus 30 europäischen Nationen durchliefen von März 1944 bis März 1945 diese Lager.
_by_philipp_rothe%20klein.jpg?f=%2Fsite%2FHeidelberg2021%2Fget%2Fparams_E-2068168584%2F5450395%2Fpd_24_04_15_KZ-Denkmal_%25281%2529_by_philipp_rothe%2520klein.jpg&w=610&h=400&m=E)
Schwere Arbeit, Mangelernährung und katastrophale Hygiene forderten bald Opfer. Von April bis Oktober 1944 wurden 78 Tote aus den Neckarlagern im Krematorium Heidelberg verbrannt, ihre Asche auf dem Friedhof Kirchheim vergraben. Sie blieben dort anonym – bis SchülerInnen der Thadden-Schule in Heidelberg nach einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz ein Erinnerungsprojekt ins Leben riefen. Ein Denkmal auf dem Friedhof Kirchheim sollte die Namen der Toten und die Ursache ihres Sterbens nennen. Zahlreiche SpenderInnen haben dazu beigetragen, dass das Projekt jetzt verwirklicht werden konnte. Nach 80 Jahren schafft das Denkmal erstmals einen Ort der Trauer für die Familien."
Das Team des Stadtarchivs freut sich, dass es die Recherchen zu diesem Projekt unterstützen konnte.
Infostand des Stadtarchivs beim Neujahrsfest am 21. Januar 2024
Die Stadt Heidelberg lud am 21. Januar 2024 bereits zum elften Mal zu ihrem traditionellen Neujahrsfest (bis 2022: Bürgerfest) ein. Die Großveranstaltung fand rund um den Marlene-Dietrich Platz und dem Karlstorbahnhof in der Südstadt statt. Knapp 100 Heidelberger Vereine, Institutionen und städtische Ämter präsentierten sich und ihre Arbeit. Zudem gab es auf der Bühne und im Außenbereich verschiedene abwechslungsreiche Programmpunkte.
Wir danken den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern an unserem Infostand für ihr Interesse.
Hip-Hop in Heidelberg: mehr als ein Kulturerbe
Unter diesem Titel hat Franziska Werner von der Universität Heidelberg für die Online-Rubrik INSIDE HCCH des „Heidelberg Zentrum Kulturelles Erbe“ („Heidelberg Center Cultural Heritage“) dem Heidelberger Hip-Hop und seinem Archiv eine spannende Reportage gewidmet: "Mehr als dreißig Jahre später steht Toni-L im Archiv seines Lebens. Wortwörtlich, denn dort werden seine Anfänge in der Gruppe Advanced Chemistry aufbewahrt – sie sind Mitbegründer des deutschen Hip-Hops. Vor wenigen Monaten, im März 2023, wurde die Hip-HopKultur in Heidelberg zum Immateriellen Kulturerbe erklärt. Ein Erbe mit subkultureller Geschichte und gewiss nachhaltiger Zukunft, wenn man sie zulässt." So beginnt Franziska Werners Reportage über die in Heidelberg entstandene Hip-Hop-Kultur. Wie es weitergeht? Sehen Sie selbst: PDF "Hip-Hop in Heidelberg zum Download
Bürgermeisterin Martina Pfister besuchte das Stadtarchiv
Bei einem Besuch im Stadtarchiv informierte sich Martina Pfister, Bürgermeisterin für Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft, über die Aufgaben und Leistungen des Teams um Dr. Peter Blum. Was in der Archivsatzung der Stadt etwas trocken formuliert ist („Das Archiv hat die Aufgabe, alle in der Verwaltung angefallenen Unterlagen […], die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden […] zu verwahren […]“) eröffnet bei der täglichen Arbeit ein breites Spektrum: viele hundert Anfragen jährlich – von „A“ wie „Amerikaner“ oder „Armenfürsorge“ bis „Z“ wie „Zuwanderung“ oder „Zwangsarbeit“ und gut ebenso viele Anfragen im Bereich der Personenrecherche.
Das Stadtarchiv ist mit seinen Informationen dabei Dienstleister für die Verwaltung – gleichermaßen für alle an der Geschichte ihrer Stadt interessierten Heidelbergerinnen und Heidelberger. Aufgrund des hohen Digitalisierungsgrads des Archivs (es war 2019 eines von drei Pilotämtern bei der Einführung des Dokumentmanagementsystems Enaio) können Nutzerinnen und Nutzer nach ihrer Onlineanmeldung unter Archivbenutzung vor Ort online recherchieren und können auch bereits viele ihrer Ergebnisse – Bilder, Akten oder Statikunterlagen – (wenn gewünscht) in digitaler Form erhalten.
Analog und damit haptisch erlebbar sind (und bleiben) die Publikationen des Archivs, von deren Wirkung auf Leserinnen und Leser sich Bürgermeisterin Pfister ebenfalls ein Bild machen konnte. Egal ob es die Graphic Novel über das „Heidenloch“, die schnell vergriffene erste Auflage des Bildbands „Heidelberg in den 50er-Jahren“ oder die jüngste Neuerscheinung über das Heinsteinwerk ist („HWH Heinsteinwerk Heidelberg. Industriekultur zwischen Funktionalität & Ästhetik. Stilkachelöfen und Sanitärkeramik aus Heidelberg 1847 – 1995“): Mit seinen Publikationen macht das Stadtarchiv historische Forschung populär – betreibt „Public History“ im besten Sinn, wie es seit einiger Zeit „neudeutsch“ heißt.
Als das historische Gedächtnis der Stadt Heidelberg heißt das Archiv natürlich „Stadtarchiv“ – ist aber von Heidelberg aus weit über Heidelberg hinaus bekannt und vernetzt. So konnte Archivdirektor Peter Blum Bürgermeisterin Pfister zum Abschluss seiner Präsentation noch über die regelmäßigen Kontakte und Aktivitäten besonders mit den Archivkolleginnen und –kollegen in China und Südamerika informieren.
Kein Wunder, dass der abschließende Gang durch die Magazinräume und damit der Blick auf die dort verwahrten sieben Regalkilometer(!) Akten zum Sprint werden musste.
Ausstellung "Heidelberg in den 50er Jahren" im Kurpfälzischen Museum
Der Heidelberger Fotograf Fritz Hartschuh hielt mit seiner Kamera die schönsten Ansichten der Stadt und viele besondere Ereignisse in den 50er Jahren fest. Auch wenn prominente Gäste Heidelberg besuchten, war der stadtbekannte Fotograf schnell zur Stelle. Dass er seine Motive auch im Alltag und in der Arbeitswelt fand, ist für den Rückblick auf dieses Jahrzehnt besonders interessant. Auch wenn die Nachkriegsjahre das Leben in Heidelberg noch lange prägten, lag der Zauber des Neubeginns bereits in der Luft. Als guter Beobachter, technisch versierter Fotograf und vielbegabter Alleskönner gelang es Hartschuh, den Zeitgeist der 50er Jahre bildlich einzufangen.
Die Ausstellung in Kooperation mit dem Stadtarchiv Heidelberg zeigte eine große Bilderauswahl von Fritz Hartschuh. Im Zusammenspiel mit originalen Filmdokumenten, Designobjekten und Bildwerken von Marie Marcks, Hanna Nagel, Will Sohl, Siegfried Czerny und Karin Bruns entstand ein vielfältiges Bild der 50er Jahre in Heidelberg.
Fritz Hartschuh, ein vielbegabter Fotograf
Fritz Hartschuh war ein aufmerksamer Beobachter des Heidelberger Alltagslebens und erreichte eine unverwechselbare Handschrift als Fotograf. So manche seiner qualitätvollen Aufnahmen fanden den Weg in die Zeitung, ins Fremdenblatt oder in Bildbände über Heidelberg. Hartschuhs Bilder vermittelten den allseits propagierten Optimismus der Jahre des Wirtschaftswunders. Die dokumentarisch und journalistisch ausgerichtete Fotografie wurde in den 1950er ein Trend, dem sich auch Fritz Hartschuh erfolgreich anschloss.
Über die Fotografie hinaus war Fritz Hartschuh ein hochgeschätzter Alleskönner. Bereits im Alter von 14 Jahren hatte Hartschuh seine Tätigkeit bei den Heidelberger Neuesten Nachrichten begonnen, wo er nach dem Ersten Weltkrieg als Kaufmann und Drucktechniker schnell zu einem der führenden Mitarbeiter der Zeitung wurde. Bei der 1945 gegründeten Rhein-Neckar-Zeitung setzte Hartschuh diese Tätigkeiten fort und wurde Werbechef und Leiter der Technik.
Prost Heidelberg! Die Geschichte der Bierbrauereien und Bierlokale in Heidelberg
Ausstellung des Heidelberger Stadtarchivs in der Universidad Complutense in Madrid eröffnet:
Ein großer Dank an unseren Ausstellungspartner Alejandro Sanchis Pastor, den Leiter des Unternehmensarchivs Mahou San Miguel! Drei Jahre Pandemie konnten die Umsetzung der gemeinsamen Pläne letztlich nicht länger aufhalten.
Wir bedanken uns zudem bei unserem Gastgeber, der Fakultät für Dokumentationswissenschaften der Madrider Universidad Complutense, an der jährlich etwa 1.000 Archivar*innen und Bibliothekar*innen ihre Ausbildung erfahren. Die feierliche Eröffnung seitens der Gastgeber vollzogen Dekan José Luis Gonzalo nebst Profesora Titular María Aurora Cuevas Cerveró und Directora Departamento Marìa Antonia Ovalle.
Unter den Gästen tummelten sich eine ganze Reihe befreundeter Archivar*innen aus Spanien (Arnao, Cuenca, Santander) sowie der aus Chile angereiste Präsident des chilenischen Archivverbands Eugenio Bustos Ruz. Unter den befreundeten Archivkolleg*innen bestand Einigkeit, die Ausstellung im kommenden Jahr nochmals an einem anderen historischen Schauplatz zu präsentieren und dies um eine Tagung zum Thema Bier- und Bierkultur zu ergänzen.
Die Ausstellung zeigt am Beispiel Heidelbergs die Geschichte des Bieres, der Brauereien und Bierlokale in facettenreichen Bildern. Darin spiegeln sich gleichermaßen Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte. Bier ist ein sogenanntes typisch deutsches Thema, für das sich allerdings selbst im für seine Weine, Cava, Sidra usw. gerühmten Spanien längst viele Parallelen aufzeigen lassen. Aus dem Unternehmensarchiv der spanischen Großbrauerei Mahou San Miguel wurden die großformatigen Ausstellungsdisplays aus Heidelberg um dreidimensionale Exponate spanischer Bierkultur bereichert.
Nach verschiedenen Präsentationen, u.a. in chinesischen Millionenmetropolen sowie in Ungarn, wurde nun die komplett neu gestaltete Ausstellung in der Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense eröffnet. Volker von Offenberg, Autor der beiden in der vom Archiv herausgegebenen Sonderveröffentlichungen und Ausstellungspartner, sowie der Leiter des Stadtarchivs führten vor Ort gemeinsam in die Ausstellung ein …
Budapester Archiv-Picknick mit Internationaler Archivbuchmesse
Zur Nachahmung empfohlen! – Heidelberger Stadtarchiv erneut mit dabei!
Einmal mehr veranstaltete das Stadtarchiv Budapest am 17. Juni 2023 sein nunmehr sechstes ‚Archivpicknick‘. Das ‚Archivpicknick‘ ist eine auf Initiative des Verbands der ungarischen Archivarinnen und Archivare 2017 begründete Veranstaltungsreihe. Mit bewusst niederschwelligen Informations- und Mitmachangeboten sollen sich Archive als moderne Informationsspeicher des nationalen Gedächtnisses präsentieren. Mit Fachprogrammen für Archivkolleg*innen, historisch Interessierte und ebenso interessierte Laien. Mit Ausstellungen, Führungen, Animationen … für Erwachsene wie Kinder! So gibt es Konzerte, einen Streichelzoo, Kinderschminken und ein mittelalterliches Militärlager. Als Gäste mit dabei waren diesmal insgesamt 22 internationale und ungarische Archive. Denen der großzügige Archivzweckbau sowie der Innenhof des Budapester Stadtarchivs ideale Gestaltungsräume bot.
Bereits 2017 hatte das Heidelberger Stadtarchiv seine Ausstellung ‚Prost Heidelberg‘ (Die Geschichte der Heidelberger Brauereien und Bierlokale) beim I. ‚Archivpicknick‘ erfolgreich präsentiert. Diesmal standen Buchveröffentlichungen der Archive im Mittelpunkt. Heidelberg konnte dabei gelegentlich einer Podiumsdiskussion sowie an einem eigenen Stand die unterschiedlichen Profile der von ihm herausgegebenen drei Veröffentlichungsreihen vorstellen. Wobei gerade jene Schriften besonderes Interesse fanden, die auf ein Publikum aus Laien und historisch Interessierten zielen. Bücher, die explizit stadtgeschichtliche Themen in gut verständlicher wie attraktiv gestalteter Form aufbereiten und Archive so aus dem ihnen bisweilen nachgesagten ‚Staub der Geschichte‘ heraustreten lassen. Denn moderne Archive vermitteln Identität und – vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung wie täuschend echter Fake News – authentische, verlässliche, auch gerichtsverwertbare Informationen!
Die Veranstaltungsreihe des Budapester Stadtarchivs offiziell unter der Headline ‚Archivpicknick‘ laufen zu lassen, zeugt u.a. vom Mut der Organisatoren, eingefahrene Wege der Selbstdarstellung von Archiven bewusst zu verlassen. Die Atmosphäre in der im Innenhof des Stadtarchivs aufgebauten ‚Zeltstadt‘ kennzeichnen jugendliche Ausgelassen- und Aufgeschlossenheit. Die Kantine des Archivs sorgt dabei ganztägig für ein exzellentes leibliches Wohl der Gäste. Am mobilen Getränkeausschank einer Mikrobrauerei gibt es unterschiedliche Bierkreationen zu verkosten, aber selbstverständlich auch Alkoholfreies zu trinken. Archivspaziergänge und Bastelaktivitäten, der Streichelzoo … locken junge Familien, denen sich neue Horizonte erschließen. Kostümierte zeigen sich in einem Militärlager des 17. Jahrhunderts (Waffenschau und Turnier). Parallel zu den den Besucher*innen gebotenen ‚Backstage-Touren‘ tauschen sich Archivar*innen sowohl untereinander als auch mit den an die 1.000 Tagesgästen aus. In der Aula zeigt das Archiv seine Aktivitäten der digitalen Gebäude- und Quartiersforschung unter dem Titel ‚Budapest Time Machine‘ …
Neugier und positive Überraschung prägen das Bild der Gäste. Archive sind so nicht länger historische Wissensspeicher für allein die eingeweihte Klientel von Fachwissenschaftlern, sondern Orte neuer Entdeckungen und Erfahrungen! So niederschwellig und locker, wie es der Generaldirektor Prof. Dr. István Kenyeres mit seinen Mitarbeiter*innen vorlebt … Alle im einheitlichen Archivoutfit (nein nicht im grauen Kittel, sondern im dunkelblauen beschrifteten Poloshirt) sofort erkennbar und jederzeit hilfsbereit, wenn die Gäste in all dem Aufgebotenen den Überblick zu verlieren drohen. Am Nachmittag bietet das Programm neben dem obligatorischen Kinderschminken, paläographische Übungen, … musikalische Kinderanimation, die gegen Abend in ein vierstündiges (!) Livekonzert mit drei professionellen Bands übergeht.
Höhepunkt und Ausklang zugleich liefert die mitreißende ungarische Tribute-Band der legendären Band Led Zeppelin: Lead Zeppelin. Da hüpfen und tanzen dann auch die Archivarinnen und Archivare begeistert vor der Bühne. Gleichwohl zeigt sich das Publikum nun deutlich gealtert. Denn die Band hat nicht wenige ihrer Fans mitgebracht, die sich von der ungewöhnlichen Archiv-Location nicht abhalten ließen. Bei ihrer Verpflichtung sollen die Bandmitglieder zunächst irritiert gefragt haben, ob sie denn jetzt mit Schlips und Anzug auf die Archivbühne sollten …? – Nein, unseren Kolleg*innen des Stadtarchivs Budapest ist Beispielhaftes wie Nachahmenswertes gelungen, und das sympathisch und verbindend: Nämlich Gegensätze zu überwinden, Klischees als solche zu entlarven und Brücken zu einem erfreulich breit gefächerten Publikum zu schlagen. Und schon heute freuen wir uns auf das VII. ‚Archivpicknick‘ im Budapester Stadtarchiv!
Das Stadtarchiv erhält Zuwachs: Der Vorlass Werner Pfisterer (MdL a.D.)
Was auf den ersten Blick als etwas hölzerner Begriff erscheint – Vorlass – ist bei näherem Hinschauen ein doppelt glücklicher Umstand. Denn anders als bei (der Übernahme von) Nachlässen lebt der Übergebende noch. Das Archiv seinerseits hat z. B. die Möglichkeit nachzufragen, falls die schriftlichen Quellen eben doch nicht alles beantworten.
Ihm, dem Landtagsabgeordneten und langjährigen Heidelberger Stadtrat Werner Pfisterer wünschen wir bei dieser Gelegenheit weitere Jahrzehnte fruchtbaren Schaffens. Was sich bislang als quasi schriftliche Dokumentation (eines Teils) dieses Politikerlebens angesammelt hat - mehr als einhundert Aktenordner mit Schriftverkehr Presseartikeln, Fotos – befindet sich zu einem Teil seit kurzem im Stadtarchiv Heidelberg.
Wie kam es dazu? Erst einmal fragte sich Werner Pfisterer, was in der Zukunft mit seinen Unterlagen passieren würde.
Wie könnte man sie für die Nachwelt erhalten? Seine Antwort: Das Stadtarchiv Heidelberg ist der richtige Ort, um diesen für die Stadtgeschichte (und darüber hinaus!) wichtigen Bestand zur verwahren, zur erschließen und für die Forschung nutzbar zu machen.
Von den beruflichen Anfängen als Feinmechaniker, dem Meistertitel, der Arbeit als Personalrat bzw. Personalratsvorsitzender, Gremienmitglied im Senat bzw. Großen Senat, Verwaltungsrat an der Universität Heidelberg von 1965-2011 sowie, Hauptpersonalrat, über die politische Arbeit als Stadtrat (seit 1989) und Landtagsabgeordneter (1996- 2011) ist in diesen Unterlagen alles dokumentiert. Beste Voraussetzungen also um eine politische Biografie zu schreiben:
Presseordner über sein Leben seit 1979 (bis heute ca. 64 Stück), drei Ordner Gemeinderatswahl 1989 und weitere von späteren Jahren, Fotoalben über die verschiedenen Termine und Dienstreisen (ca. 41 Stück), Terminkalender, ein USB-Stick mit Bildern von 2001 bis heute, Plakate Feiern und Ehrungen mit bzw. durch bekannten Persönlichkeiten
Es bleibt zu hoffen, dass andere sich von diesem Beispiel ermutigen lassen und ebenfalls schon zu Lebzeiten den schriftlichen Niederschlag ihres Schaffens dem Stadtarchiv anbieten und übergeben.
Festveranstaltung zur Neueintragung von Kulturformen in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Potsdam
Bereits am 15. März hatte die Kulturministerkonferenz gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien die Auswahlempfehlungen des Fachkomitees Immaterielles Kulturerbe der Deutschen UNESCO-Kommission bestätigt. Das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes wurde damit um 13 Einträge erweitert. "Aufgenommen wurden unter anderem", so heißt es auf der Website der deutschen UNESCO-Kommission, "die Hip-Hop-Kultur in Heidelberg, der Zirkus als eine Form Darstellender Kunst und der Bau des Spreewaldkahns. Darüber hinaus wurden zwei Modellprogramme gewürdigt, die beispielhaft zeigen, wie das Immaterielle Kulturerbe bewahrt werden kann. Das Bundesweite Verzeichnis umfasst damit insgesamt 144 Formen gelebter Kultur in Deutschland."
Jetzt wurden in Potsdam die Urkunden (77 KB) verliehen.
Zwei Ölgemälde des Heidelberger Malers Rainer Motz ("Munke") finden im Stadtarchiv ein neues Zuhause
Sehr erhellend äußert sich über dieses Bild Dr. Hans-Jürgen Kotzur, Autor mehrerer Bücher über Rainer Motz und profunder Kenner seines Werks:
"Der Duktus der Pinselstriche und die Stärke des Farbauftrags", so Hans-Jürgen Kotzur, "sind noch stark dem Expressionismus verpflichtet, das Bild gehört stilistisch zum Frühwerk Munkes.
Interessant ist das Gemälde aber wegen des Themas und seiner versteckten Anspielungen. Seine besondere Affinität zur kath. Kirche konnte Munke nie verleugnen.
Ihn faszinierten die Liturgie mit ihren Riten und Düften des Weihrauchs, die prachtvollen Gewänder und die besondere Atmosphäre in den prunkvoll ausgestatteten Kirchen.
Theologisch dachte er aber eindeutig als Protestant im Sinne der Lehre Luthers. Dieses konfessionell bedingte Lagerdenken kommt in all seinen diesbezüglichen Bildern zum Ausdruck, sei es bei seiner Kritik an der kirchlichen Moralvorstellung oder der hierarchisch strukturierten Organisation der kath. Kirche.
Im Hintergrund des Bildes steht ein Pfarrer asketischen Aussehens, vordergründig von zwei jungen Messdienern flankiert. Der rechte Ministrant trägt eine Laterne, der andere statt des zu erwartenden Weihrauchfasses eine Lilie in der Hand. Die Lilie als ikonographisches Symbol der Keuschheit zeichnet den Jungen als unschuldig und rein aus. Dieses bewusst gewählte Attribut scheint einen Grund gehabt zu haben.
Offensichtlich wusste Munke von einem sexuellen Übergriff, vielleicht hatte er auch eigene Erfahrungen dieser Art.
Solche Vorgänge wurden zur Zeit der Entstehung des Bildes weitgehend tabuisiert, über sexuelles Fehlverhalten in der Kirche wurde in der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht gesprochen.
Für Munke, der sich relativ früh zu seiner Homosexuallität bekannte, war es unmöglich, das Thema „Missbrauch“ anzusprechen. Also deutete er es wenigstens in seinen Bildern an. Auffallend ist die Parallele zu weiteren Darstellungen mit dem jeweils gleichen Jungen und der fast identischen weißen Lilie. Trotz seiner 60 Jahre hat das Bild von seiner Aktualität bis heute nichts eingebüßt. Es ist somit ein Dokument von hoher Brisanz."
Über dieses Bild schreibt Hans-Jürgen Kotzur: "Es gehört stilistisch und thematisch in die Reihe der zahlreichen makabren Bildwerke, die Munke zwischen 1967 und 1978 geschaffen hat.
Munke liebte geheimnisvolle Keller. Er malte sie häufig und gern, sie beflügelten seine Phantasie. Dementsprechend oft bilden sie die markanten Raumfolien auf seinen Gemälden.
Durch ein vergittertes Fenster dringt nur spärlich Licht in den Kellerraum, in dem sich auf einer Holzkiste ein großes Einmachglas mit einem abgetrennten menschlichen Kopf befindet. Daneben liegt ein einfacher Handbesen wie zur Verharmlosung der makabren Szenerie. Das Etikett auf dem Glas zeigt die Jahreszahl 1969, ein aufgeklebter Zettel auf der Kiste mit der Namensnennung des Künstlers ersetzt die Bildsignatur. Der Schädel im Glas steht auf dem Kopf, er wirkt erschreckend morbid.
Das Gesicht ist gut zu erkennen, aber der Verfall hat schon nachhaltige Spuren hinterlassen. Gut erhalten präsentiert sich die Augenpartie, die ein geschlossenes und ein geöffnetes Auge zeigt.
Die Schlangenhaare bestätigen die Vermutung, dass der Kopf von dem geflügelten Fabelwesen Medusa stammt, die im Unterschied zu ihren unsterblichen Schwestern Sthenno und Euryale von Perseus enthauptet wurde. Der Blick dieser drei Gorgonen
soll jeden Betrachter in Angst und Schrecken versetzt und dann versteinert haben. Der griechischen Mythologie zufolge gelang es dennoch Perseus dieser Gefahr zu widerstehen und Medusa zu töten."
Immaterielles Kulturerbe: Deutsche UNESCO-Kommission zeichnet Heidelberger Hip-Hop aus

Heidelberg ist eine der zentralen Städte des deutschsprachigen Hip-Hop. Die besondere Bedeutung Heidelbergs in der Hip-Hop-Kultur hat nun die deutsche UNESCO-Kommission gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz in besonderer Art und Weise gewürdigt: Der Heidelberger Hip-Hop wird in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. „Aufgrund der historischen Rolle Heidelbergs gilt die Stadt als Erinnerungsort für die Entwicklung der deutschsprachigen Hip-Hop-Kultur. Sie zeichnet sich durch ihren offenen Partizipationscharakter und eine breite Vernetzung in Deutschland aus“, heißt es zur Begründung. Den Antrag zur Aufnahme in das Verzeichnis hatte die Stadt Heidelberg im Jahr 2021 gemeinsam mit Akteuren aus der Hip-Hop-Szene, allen voran der Hip-Hop-Forscher Bryan Vit, gestellt.
Hardware, Ton- und Datenträger, Zeitschriften, Plakate und vieles mehr lassen im Stadtarchiv Heidelberg das Hip-Hop-Archiv entstehen.
Heidelberg geht einen weiteren Schritt auf dem Weg zum digitalen Stadtarchiv
Einen weiteren Schritt hin zum digitalen Stadtarchiv hat das Digitalförderprogramm „WissensWandel, Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur“ ermöglicht. Mit Mitteln der Bundeskulturbeauftragten und unterstützt vom Deutschen Bibliotheksverband (dbv) konnten nach einer ersten Förderung 2021erneut 2022 umfangreiche Aktenbestände digitalisiert werden.
Diese Digitalisierungsstrategie des Stadtarchivs sichert zum einen wichtige Teilbestände dauerhaft in digitaler Form: Die Digitalisate werden im „Digitalen Magazin“ DIMAG, eine Entwicklung des Landesarchivs Baden-Württemberg, gespeichert. Dank dezentraler Speicherung und regelmäßiger Migration in neue Dateiformate bleibt das historische Gedächtnis der Stadt Heidelberg intakt und aktiv. Aktiv werden können auch die Nutzerinnen und Nutzer des Heidelberger Archivguts: Anders als bisher können sie es bald rund um die Uhr weltweit einsehen (Online-Zugang vorausgesetzt). Auf den Portalen „Deutsche digitale Bibliothek“, dem „Archivportal Deutschland“ und nicht zuletzt auf der Website des Stadtarchivs selbst entsteht ein virtueller Lesesaal. Dessen Bandbreite reicht von „A“ wie „Armenfürsorge“ bis „Z“ wie „Zuwanderung“. Der Zugang zu den digitalisierten Dokumenten wird im nun schrittweise für die Öffentlichkeit freigeschaltet.
Dabei war die Auswahl der Akten – mit insgesamt mehr als 700.000 Seiten – eine besondere Herausforderung. Unter dem Projekttitel „Die Sozialstadt: Wie kam es zur Stadt von heute?“ finden sich Unterlagen, die Antworten geben auf Fragen wie: „Was förderte oder erschwerte das Zusammenleben städtischer Mehrheiten und Minderheiten wie Juden, Sinti und Roma und Migranten?“. Nutzerinnen und Nutzern bietet sich abhängig vom Endgerät dank Zoom-Funktion eine verbesserte Lesbarkeit; dank OCR-Erschließung und möglicher Vorlesefunktion weitgehend ohne störende Barrieren.
Auf den Spuren der Stadtgeschichte: Geführte Rundgänge in der „MeinHD“-App verfügbar
Auftakt mit den Themen „68er-Bewegung“ und „US-Amerikaner in Heidelberg“
Wer in Heidelberg nach Orten mit historischer Bedeutung sucht, braucht nicht weit zu gehen. Im Gegenteil: Die schiere Fülle verleitet eher dazu, an dem ein oder anderen Schauplatz ungeachtet vorbeizulaufen. Einen bewussten Blick auf diese Punkte ermöglicht eine neue Funktion der „MeinHeidelberg“-App. In zunächst zwei kulturhistorischen Stadttouren können Nutzerinnen und Nutzer – geführt durch die App – in die jüngere Stadtgeschichte eintauchen. Die beiden Touren unter den Titeln „Heidelberg und die 68er“ und „US-Amerikaner in Heidelberg“ sind in einem gemeinsamen Projekt des Historischen Seminars der Universität Heidelberg, des Universitätsarchivs sowie des Stadtarchivs und dem Amt für Digitales und Informationsverarbeitung der Stadt Heidelberg entstanden und in der „MeinHeidelberg“-App ab sofort unter der Rubrik „Erleben“ zu finden.
Die Stadtführungen folgen einer festgelegten Route, die in der App auf einer Übersichtskarte angezeigt wird. Hat man eine der beiden verfügbaren Touren ausgewählt, zeigt die App an den einzelnen Stationen einen Infotext sowie ergänzende Bilder. Die Texte sind außerdem voll vertont und können alternativ über das Smartphone abgespielt werden. Wer statt der ganzen Führung gezielt einzelne Stationen ansteuern möchte, kann das ebenfalls tun: Per GPS erkennt die „MeinHeidelberg“-App, wo sich die Nutzerinnen und Nutzer befinden, und zeigt den passenden Text zur aktuellen Station an.
„Die ‚MeinHeidelberg‘-App ist so etwas wie die Stadtverwaltung zum Mitnehmen. Sie bündelt umfassende Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen, Zugang zu nützlichen Datenquellen wie dem Klimakompass oder Themenkarten, etwa zu Spielplätzen oder öffentlichen Toiletten. Dass die App auch zum Reisebegleiter werden kann, zeigt, wie viel Potential noch in der App steckt“, erklärt Dr. Philipp Lechleiter, Abteilungsleiter Digitale Stadt beim Amt für Digitales und Informationsverarbeitung. Projektentwickler Sebastian Bernhard ergänzt: „Die ersten beiden Themenführungen sind sicher vor allem für Heidelbergerinnen und Heidelberger interessant, die zur ein oder anderen Station vielleicht sogar einen persönlichen Bezug haben. Aber die Möglichkeiten sind groß und unser Ideenspeicher schon mit einigen Optionen für abwechslungsreiche weitere Touren gefüllt.“
Vor 50 Jahren: Heidelberg als Austragungsort der "XXI. Weltspiele der Gelähmten", Vorläufer der Paralympics
Vor 50 Jahren fanden die XXI. Weltspiele der Gelähmten, die "International Stoke Mandeville Games", in Heidelberg statt. Die Spiele, die heute als „Paralympics“ bekannt sind, wurden im Jahr 1972 am Institut für Sport und Sportwissenschaft (ISSW) der Universität Heidelberg und dem Olympiastützpunkt Rhein-Neckar (damals: Bundesleistungszentrum) durchgeführt. Rund 1.000 Athleten und Athletinnen aus 41 verschiedenen Ländern traten vom 1. bis 10. August 1972 in verschiedenen Disziplinen an.
Dies war der Anlass für eine von Studierenden organisierten Festveranstaltung im Institut für Sportwissenschaften. Mit einem Vortrag blickte Daniel Westermann, Autor des in der Schriftenreihe des Stadtarchivs erschienenen Diplomarbeit über die Spiele 1972. Danach warf Nadja Verhoeven, Lehrbeauftragte am ISSW einen Blick auf die aktuellen Herausforderungen des Sports von Menschen mit Handicap.
Noch bis Jahresende kann im ISSW dank der Unterstützung durch das Stadtarchiv eine Ausstellung mit Fotos und Zeitungsausschnitten zu den Heidelberger Spielen von 1972 in Augenschein genommen werden.
Heidelberger Hip-Hop auf dem Weg zum Immateriellen Kulturerbe
Landesjury bewertet Antrag des Stadtarchivs positiv und leitet ihn an Kultusministerkonferenz weiter
Ein erster Schritt im Verfahren zur Aufnahme des Heidelberger Hip-Hop in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO ist geschafft: Die dreiköpfige Landesjury hat entschieden, dass der Heidelberger Hip-Hop die nötigen Bedingungen erfüllt und den Antrag zusammen mit drei weiteren Kandidaten aus Baden-Württemberg an die Kultusministerkonferenz weitergeleitet. Das geht aus einem Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg an das Stadtarchiv Heidelberg hervor. Das Team des Stadtarchivs hatte den Antrag zusammen mit Bryan Vit (Doktorand an der Universität Heidelberg und wissenschaftlicher Berater im Projekt Hip-Hop Archiv) und den beiden Gutachtern Prof. Dr. Henry Keazor (Lehrstuhlinhaber am Institut für Europäische Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg) und Joshua Modler (SWR-Musikredakteur) ausgearbeitet.
Im Stadtarchiv – seit 2019 auch Sitz des „Heidelberger Hip-Hop-Archivs“ – freut man sich über die positive Entscheidung, genauso wie Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson, der den Antrag effektiv unterstützt hat: „Heidelberg ist die Wiege des deutschsprachigen Hip-Hops. Von hier aus wurde die Hip-Hop-Kultur in ganz Deutschland nachhaltig geprägt. Ich freue mich sehr, dass die Landesjury den Einfluss Heidelbergs auf die deutsche Hip-Hop-Kultur bestätigt. Unsere Bewerbung hat es nun – ausgewählt aus einer zweistelligen Anzahl von Mitbewerbungen – als eine von vieren aus Baden-Württemberg in den Auswahlpool des nationalen Kulturerbes geschafft und damit ein wichtiges Zwischenziel erreicht.“
Im nächsten Schritt wird das Expertenkomitee für das Immaterielle Kulturerbe bei der Deutschen UNESCO-Kommission e. V. (DUK) die Anträge begutachten und ihre Empfehlungen aussprechen, die abschließend von der Kultusministerkonferenz bestätig werden. Eine Entscheidung wird frühestens im Herbst 2022 erwartet.
Neues aus dem Heidelberger Hip-Hop-Archiv: ein Kunstdruck-Porträt des Deutschrap-Pioniers Torch
Dank der Großzügigkeit von Lion Oeding, Hip-Hop-Fan aus Stuttgart, kann sich das Archiv über ein großformatiges Porträt von Frederik Hahn – bekannt als „Torch“ freuen. Nicht auf Leinwand, sondern auf Metall gebannt hat ihn der bekannte Stuttgarter Grafikdesigner und Fotograf Kai Effinger. Das Material des Kunstwerks ist besonders; die Technik außergewöhnlich: Dunkler Hintergrund. Nur zwei Computerbildschirme dienen als Lichtquelle. Diese verleihen der abgelichteten Person den eigentümlichen Reiz eines Nachtporträts. Mehr als 500 bekannte wie weniger bekannte Menschen hat der Künstler derart porträtiert. Torch ist einer davon.
Stichwort „Quelle“: Effinger wünscht sich natürlich, dass für dieses und andere Porträts Geld sprudelt. Allerdings nicht für ihn selbst, sondern für sein Projekt „Licht An – Blattkunst supports Viva con Agua“. Mit ihm will er auf die Trinkwasserknappheit in Afrika aufmerksam machen.
Der Leihgeber Lion Oeding hat jetzt gleich doppelt Gutes bewirkt. Indem er dieses Porträt ersteigerte, unterstützt er den Kampf für sauberes Wasser in Afrika. Mit Weitergabe dieses Unikats an das Heidelberger Stadtarchiv bereichert er dessen einzigartiges Hip-Hop-Archiv und macht er das Kunstwerk zudem der Allgemeinheit zugänglich!
Digitale Weiterentwicklung des Stadtarchivs dank Förderung durch Digitalprogramm WissensWandel
Das Stadtarchiv Heidelberg geht einen weiteren Schritt hin zum digitalen Archiv. Über einen Zeitraum von vier Monaten wurden über 60.000 Seiten historischer Aktenbestände digitalisiert und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Archivs geprüft. Sie werden nun in das Datenbanksystem „FAUST“ eingepflegt, wo sie den Nutzerinnen und Nutzern des Archivs schrittweise zugänglich gemacht werden sollen. Durch den digitalen Zugang zu den Akten wird die Recherche deutlich vereinfacht.
Möglich wurde das durch einen Zuschuss von rund 10.000 Euro aus dem Förderprogramm „WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur“. Mit diesem Programm unterstützt der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) Bibliotheken und Archive bei ihrer digitalen Weiterentwicklung. Das Programm ist Teil des Rettungs- und Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Es soll einen Beitrag dazu leisten, die Folgen der Corona-Pandemie für Bibliotheken und Archive zu mildern.
Bei den Akten aus dem 18. und 19. Jahrhundert handelt es sich um historische Quellen mit einem hohen Informationsgehalt: Von „A“ wie „Armenwesen“ oder „Auswanderung“, bis „S“ wie „Schulen“, „U“ wie Universität bis zu „Z“ wie „Zuzug“ bietet dieser nun digital vorliegende Bestand eine hervorragende Basis für die historische Forschung. Die Aussagekraft geht dabei deutlich über die lokale Ebene hinaus: Auch regionale und überregionale Ereignisse und Entwicklungen finden hier ihren Niederschlag – beispielsweise die Bekämpfung der Kuhpocken, bei der schon vor 200 Jahren Impfbescheinigungen ausgestellt wurden.
Szenische Lesung "Das Heidenloch"
...in der Reihe „One Hit Wonder“
17. Dezember 2021. Gut 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung der fantastisch-mythologischen Romanvorlage. Der aufgrund des Publikumsinteresses zwischenzeitig eine E-Book-Version und gemeinsam mit dem SWR ein atmosphärisch intensives „Pfälzisches Schauer(hör)spiel“ folgten. Und im Jahr 2021 der atemberaubende Thrill einer „Heidelberg Graphic Novel“. Es ist 20:00 Uhr, als sich auf der Bühne des Zwinger 1 die Nebelschwaden verziehen, und im schummrigen Lichte der Schreibtischlampen drei Akteure, an karg bestückten Schreibtischen sitzend, aus der Dunkelheit auftauchen
Was im schlichten Bühnendeutsch als „szenische Lesung“ angekündigt ist, nimmt rasch wie beklemmend das Publikum gefangen. Die drei Akteure machen die Romanvorlage blitzartig lebendig. Sie schlüpfen in unterschiedliche Rollen. Mal in die der Verfasser von Schreckensberichten und Sitzungsprotokollen des Krisenstabs, mal in jene der um Beistand und Aufklärung bemühten wissenschaftlichen Experten. Sie tun dies abwechselnd. Sie geben dem Schrecken der Zeitgenossen im Jahr 1907 Körper und Stimme. Mit gekonnt expressiver Gestik und Mimik.
Die machen ihren Job so gut oder vielleicht doch zu fulminant, zu stimmungsgeladen, dass daraus wiederholt ein szenischer Disput mit den drei im Vordergrund sitzenden Akteuren erwächst. Damit gewinnt das Zusammenspiel auf der Bühne zusätzlich komödiantische Anmutung. Dies alles vor flächig eingeblendeten, technisch verfremdeten Fotos der Originalschauplätze. Diese changieren unregelmäßig, aber doch bedrückend spürbar vom nüchternen und doch schreckensbleichen Schwarzweiß ins aufwühlend Blutrot.
Die Story setzen wir im Publikum einmal als bekannt voraus. Die Szenische Lesung folgt dem weitgehend treu. Aber auch „Neigeplackte“ erfahren und fühlen binnen nur weniger Minuten, was hier Grausiges abgeht. Der sprachliche Ausdruck wechselt vom papiernen Amtsdeutsch der vorgetragenen Augenzeugen- und Kommissionsberichte bisweilen ins mundartliche Idiom. Das schafft entwaffnende Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit, ja Authentizität – und sorgt zudem kraft des Engagements der drei Akteure für eine gelungene Brise Witz. Aber stets nur so viel, dass es der Ernsthaftigkeit des dargestellten Horrors – auch der eigenen Fantasie – keinen Abbruch tut!Der Geräuschemeister des Theaters war offenbar gerade wegen virtueller Weihnachtsfeiern unabkömmlich. Aber wozu auch? Ein dramaturgisch gelungener Kniff: Lasst unsere drei Akteure die Rassel drehen, mit Raspeln und Reiben und mit was auch immer stimmige Töne zu entlocken sind agieren und ins umgedrehte Megaphon schreien ‚Ich bin jetzt ganz unten‘ (im Heidenloch). Da zeigen unsere drei Akteure im Vordergrund, was sie alles ‚draufhaben'.
Das verleiht zusätzlich komödiantischen Witz, vielleicht gar eine Brise Esprit eines blitzsauberen Happenings. Gleichwohl bleibt das Grauen bis in die hintersten Sitzreihen nach wie vor präsent! Allein der Intendant freut sich über potentielle Einsparoptionen bei der Technik ohne Einbuße an expressiv-kreativem Schauspieltalent – beim nächsten Mal gibt der Chefdramaturg persönlich die Stehlampe, wenn er seine Künstler und die eine Künstlerin virtuos ins Scheinwerferlicht setzt. – Nein, es soll hier nicht despektierlich wirken! Aber gerade durch den minimalistischen Inszenierungsansatz fordert er allen Akteuren alles ab, was Theater attraktiv und lohnend macht. Und das, was hier präsentiert wird, ist keinesfalls Variante des soundsovielten Aufgusses und damit der ‚Drops gelutscht‘. Nein die ‚szenische Lesung‘ ist eine eigenständige Theaterperformance, die sich würdig wie kreativ neben der Buchvorlage, dem Hörspielarrangement und der Graphic Novel zu behaupten weiß. – Keine Frage, die Horror-Performance gehört ins feste Theaterrepertoire, auf die Bühne und nicht ins Archivmagazin – auch wenn der Stoff aus dem Archiv kommt …
Wenn Sie wissen wollen...
...was es Neues in den Archiven gibt, schauen Sie doch einmal auf unsere Seite Querbeet. Dort stellen wir Ihnen die Schweizer Band SOUNDKITCHEN vor. Was diese Band mit einem Archiv/Archivar zu tun hat? Schauen Sie selbst.
Und ganz aktuell: Sie ist da! Die Graphic Novel "Das Heidenloch"... SWR, Mannheimer Morgen, Rhein-Neckar-Zeitung und das Stadtblatt haben sich bereits ein Bild gemacht:
Das Heidenloch SWR vom 22.07.2021
Das Heidenloch MaMo vom 02.08.2021 (340 KB)
Das Heidenloch RNZ vom 05.08.2021 (355 KB)
Das Heidenloch Stadtblatt vom 04.08.2021 (257 KB)